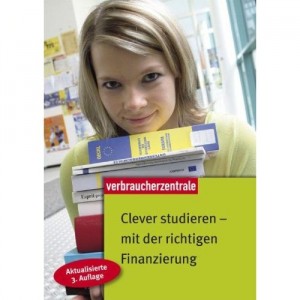Joana Pinho steht kurz vor ihrem Abschluss in Architektur an der Technischen Universität Lissabon. Sie stammt aus Porto, wo sie bereits einen Abschluss in Städtebau gemacht hat. Bei ihrem derzeitigen Studium handelt es sich um ihren zweiten Studiengang – sie hat bereits einen Abschluss in Städtebaubesen. Wir unterhielten uns über ihr Studium und die Gründe ihrer Studienwahl.
| Name | Joana Pinho |
| Alter | 29 Jahre |
| Hochschule | IST – Technische Universität Lissabon |
| Studiengang | Architektur |
| Studienjahr | Fünftes Studienjahr |

Sebastian: Warum hast du Dich für Dein Programm und Deine Hochschule entschieden?
Joana: Diese Hochschule war ehrlich gesagt meine zweite Wahl. Der Hauptgrund, warum ich hier studieren wollte, lag im Studienprogramm begründet. Mein Programm ist relativ ähnlich aufgebaut wie Architekturprogramme in Deutschland, England oder Spanien. Mein Architekturstudium ist technisch orientiert und nicht wie an anderen portugiesischen Hochschulen künstlerisch.
Was gefällt Dir an Deinem Studiengang?
Die Multidisziplinarität. Mein Studium ist im positiven Sinne unspezifisch.
Was gefällt Dir an Deinem Studiengang weniger?
Es gibt Verbesserungspotential. Man könnte mehr Theorie lehren. Außerdem sollten die Vorlesungen besser aufeinander abgestimmt werden.
Wie war das Aufnahmeverfahren für deinen Studiengang? Was musstest Du tun oder vorweisen?
Nun, in Portugal gibt es einen nationalen Aufnahmeprozess. Man bewirbt sich mit seiner Abiturnote. Die Hochschulen können dabei einzelne Fächer gewichten. Bei der Architektur ist zum Beispiel die Geometrienote die wichtigste. Ich weiß, dass Bewerbungsprozesse in Ländern anders verlaufen und Noten nicht immer das einzige Kriterium sind.
Zahlst du Studiengebühren? Wenn ja wieviel?
Ich zahle von Jahr zu Jahr mehr. Derzeit liegen die Studiengebühren an meiner bei 995 Euro pro Jahr. Als ich mein Studium vor fünf Jahren begann, waren es weniger als 850 Euro. Alle staatlichen Hochschulen verlangen Studiengebühren, allerdings gibt es leichte Unterschiede.
Wie finanzierst Du Dein Studium?
In erster Linie durch Arbeiten, allerdings erhalte ich auch ein wenig Hilfe von meinen Eltern.
Wie viel Geld braucht ein normaler Student in deiner Stadt pro Monat fürs Leben?
Man braucht zwischen 650 und 700 Euro, um relaxt leben zu können. Man ist nicht reich, kann aber seine Grundbedürfnisse befriedigen.
Was möchtest du nach Deinem Studium beruflich tun?
Ich freue mich darauf, in meinem Studienbereich zu arbeiten. Ich arbeite bereits neben dem Studium, allerdings leider nicht im Architekturbereich. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, eine zeitlang im Ausland zu arbeiten, da ich unter anderem gerne meine Sprachkenntnisse verbessern würde. Langfristig möchte ich allerdings in Portugal leben. Ich würde mit meiner Arbeit gerne auch sozial etwas gutes tun.
Würdest Du einem deutschen Studenten empfehlen, an Deiner Universität zu studieren? Warum?
Mein Studiengang ist noch recht jung, etwa 10 Jahre alt, wobei es sich um eine sehr traditionsreiche Universität handelt. Der Kurs hat nur wenige Studenten; es werden etwa 60 Leute pro Jahr genommen. Der Hauptnachteil ist, dass das Curriculum sehr unflexibel ist. Allerdings ist der soziale Zusammenhalt zwischen den Studenten größer als an anderen Hochschulen. Innerhalb Portugal gehört meine Hochschule zu den fünf besten, die ich internationalen Studenten empfehlen würde. Wir haben einige interessante Dozenten, allerdings sind die Arbeitsbedingungen nicht besser als in anderen Ländern.
Möchtest du noch etwas hinzufügen?
Unter unseren Lehrern sind viele bekannte portugiesische Architekten. Dadurch beschäftigen wir uns stark mit kontemporärer portugiesischer Architektur. Wir beschäftigen uns natürlich ebenfalls mit den weltweit bekannten Namen, allerdings steht portugiesische Architektur im Vordergrund.
Weitere Infos zum Studium in Portugal gibt es beim DAAD.